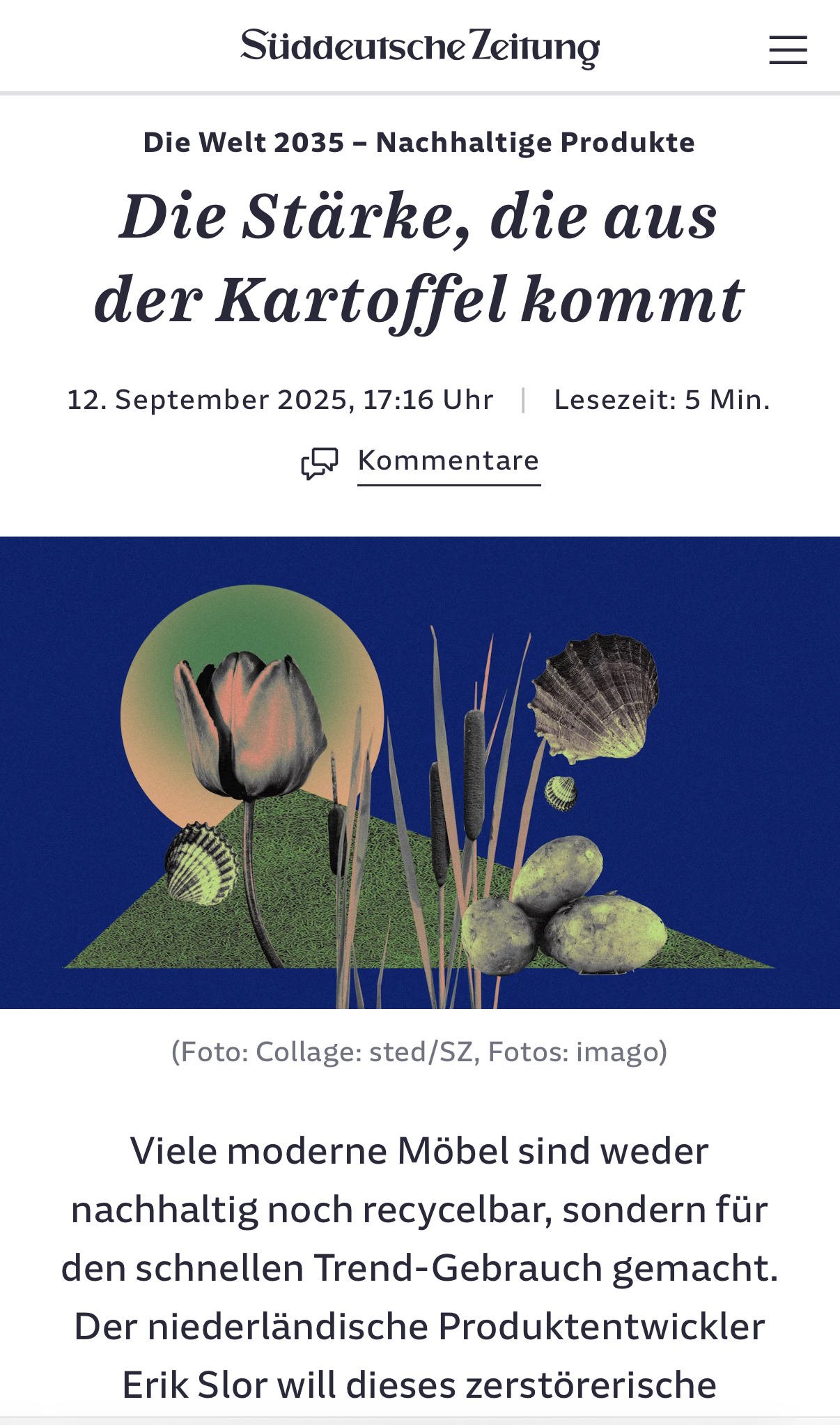

Die Stärke, die aus der Kartoffel kommt
Interview: Thomas Kirchner
Viele moderne Möbel sind weder nachhaltig noch recycelbar, sondern für den schnellen Trend-Gebrauch gemacht. Der niederländische Produktentwickler Erik Slor will dieses zerstörerische System überwinden.
München – Die Welt hat endliche Ressourcen. Aber wir tun so, als wären sie unerschöpflich. Was kann man daran ändern? Ein Gespräch mit dem niederländischen Biochemiker und Ökotoxikologen Erik Slor, der innovative nachhaltige Materialien für Industrie, Bau und Design entwickelt.
SZ: Herr Slor, Sie haben vor einiger Zeit an einem Experiment teilgenommen. Es ging darum, ein hölzernes Babybettchen komplett ohne fossile Brennstoffe und ohne Ausstoß von Kohlendioxid herzustellen. Am Ende kostete es 26 458 Euro, inklusive handgewebtem Bettzeug aus lokaler Wolle. Was lernt man daraus?
Erik Slor: Dass wir noch weit davon entfernt sind, fossile Brennstoffe wirklich hinter uns zu lassen. Ob Material, Transport oder Verarbeitung, sie stecken in all unseren Systemen.
Warum ist es so schwierig, davon loszukommen?
Unser Wirtschaftssystem basiert auf Wachstum und schnellen Materialkreisläufen. Produkte werden oft nur für kurze Zeit genutzt, egal ob Autos, Tische oder Kleidung. Dafür verbrauchen wir große Mengen fossiler Energie und Rohstoffe. Es lohnt sich finanziell, Dinge herzustellen, zu verkaufen und schnell zu ersetzen. Dieses Prinzip treibt die Industrie, die Politik und letztlich auch unser Konsumverhalten an. Und wie könnte es anders laufen?
Für echte Veränderung braucht es zwei Dinge: eine kritische Masse von Menschen, die neue Wege gehen wollen, und neue Technologien, die das ermöglichen. Ein gutes Beispiel ist das Babybettprojekt: Die Idee allein reicht nicht. Es sind viele Mitwirkende, Handwerker, Designer nötig, die gemeinsam an einer anderen Art von Produktion arbeiten.
Was, wenn wir so weitermachen wie bisher?
Wir sitzen in einem Zug, der immer schneller fährt und kaum noch anhält. Der Verbrauch steigt, der Ressourcenbedarf wächst, und wir bewegen uns im Kreis, ohne Richtung. Wenn sich nichts ändert, wird das System irgendwann an seine Grenzen stoßen.
Wie könnte man diesen Zug stoppen?
Was uns betrifft: Wir arbeiten wie in einem Labor an nachhaltigen Materialien für ein anderes Wirtschaftssystem, suchen zusammen mit Partnern nach neuartigen Baustoffen und neuer Bautechnik, das ist fundamentale Forschungsarbeit. Unsere Bio-Grundstoffe sind Kartoffelschalen, Gras, Algen, Muscheln, Reste von Rosen, Tulpen und Ähnliches. Wir stellen Klebstoffe und Bindemittel auf Stärkebasis her, sie können in Möbeln, Teppichen, Laminierungen oder für Etiketten verwendet werden. Daneben arbeiten wir an nicht-toxischen umweltfreundlichen Polymeren, die etwa bei Farben oder Beschichtungen zum Einsatz kommen. Es geht jeweils darum, die fossile Lösung durch biobasierte Hochleistungsprodukte zu ersetzen.
Mit wem arbeiten Sie zusammen?
Ich stamme aus einer Familie von Stärkeproduzenten und bin deshalb breit vernetzt mit Landwirten. Wir kooperieren mit Kartoffelbauern, aber auch mit Tulpenzüchtern und mit der größten niederländischen Molkerei. Ich weiß, wohin die Trends in der Landwirtschaft gehen, und habe mich mit Saatgutbehandlung beschäftigt. Wir liefern Bio-Beschichtungen, damit die Samen besser keimen und geschützt sind. Üblicherweise kommt dabei Chemie auf fossiler Basis zum Einsatz. Gerade gründen wir ein Konsortium, das Regenerative Farmers Lab, bei dem sich alles um das Thema Boden dreht.
Warum ist Ihnen der Boden so wichtig?
Er ist eine Lebensquelle und die Grundlage für sehr vieles: Ernährung, Gesundheit, Rohstoffe. Das Problem ist: Wir entnehmen dem Boden in der Regel nur etwas, geben aber nichts zurück. Deshalb wird im alternativen Landbau viel von Bodenregeneration gesprochen. Wir brauchen Fasern für unsere Baustoffe. Die beziehen wir etwa aus Rohrkolben. Die Pflanze wird in den Niederlanden jetzt verstärkt angebaut, weil sie hilft, neues Land zu gewinnen, und zum Wasserschutz beiträgt. Neben den Fasern bleibt ein Rest, den wir mit Bakterien oder Pilzen bearbeiten und dem Boden zurückgeben.
Es wäre schön, Ihre Produkte eines Tages bei großen Firmen zu sehen. Ist das realistisch?
Wir liefern bereits biobasierte Holzleime an Zulieferer von Ikea. Wir haben mit ihnen diskutiert, sie sagten, sie wollten ihren fossilen Fußabdruck verringern. Natürlich kam gleich der Hinweis auf die hohen Kosten, aber ich beende solche Diskussionen schnell: Denn es rechnet sich langfristig. Ich habe die Designer gefragt: Wann werden wir das Logo mal in Grün und Gelb sehen statt Blau und Gelb? Nicht als Marketingtrick, sondern als Ausdruck eines neuen Denkens.
Ohne ein Umdenken auch vonseiten der Verbraucher geht es wohl nicht.
Unsere Gesellschaft hat den Bezug zu den Materialien verloren. Wir wissen oft gar nicht mehr, woraus Dinge bestehen. In unseren Fabriken erleben wir aber: Wenn Menschen die Materialien mit eigenen Augen sehen – wie sie ankommen, sich verändern, verarbeitet werden –, dann entwickeln sie eine tiefere Bindung dazu. Es gibt viele Menschen, die nachhaltige Materialien wollen. Wer sich zum Beispiel eine teure neue Küche anschafft, wünscht sich, dass sie 30 Jahre hält. So wie früher, als man einen Tisch kaufte, der Generationen überdauerte. Wenn wir einen Tisch auf der Basis von Gras oder Rohrkolben herstellen, dann dauert das etwas länger, jedes Stück ist einzigartig, und genau das suchen die Kunden wieder.
Wann werden Sie vom Nischen- zum Massenanbieter?
Ehrlich gesagt, wir werden von der Nachfrage nach biobasierten Materialien im Moment überrollt. 2027 ist ein wichtiger Zeitpunkt, dann greift die neue EU-Mikroplastikverordnung noch stärker. Viele Unternehmen und Forschende haben sich darauf vorbereitet. Doch einige eben nicht, und bei denen spüren wir eine gewisse Panik.
Wie nachhaltig sind wir in Europa schon?
Es hat sich viel getan, aber wir kommen nicht schnell genug voran. Ich sehe häufig Folgendes: Ein Unternehmen investiert über 15 oder 25 Jahre Millionen in eine Produktionsanlage. Die Ausgabe muss sich über Jahrzehnte amortisieren. Und wenn wir dann mit einer neuen biobasierten Technologie kommen, erzeugt das Unruhe bei allen Beteiligten. Weil das bestehende System keine Flexibilität zulässt. Was wir stattdessen erleben, ist eine Art Theater – in der Politik, in Unternehmen. Alle scheinen etwas zu tun, aber es ist oft nur symbolisch, um Zeit zu gewinnen.
Was müsste geschehen?
Wenn es eine neue, bessere Technologie gibt, sollte man die alte eigentlich sofort stoppen. Doch unser Wirtschaftssystem ist auf Wachstum und Stabilität ausgelegt, nicht auf Flexibilität. Darum dauert ein grundlegender Wandel so lange, und die Umsetzung geschieht oft nur halbherzig.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ich war bei einem deutschen Unternehmen, das Zellulosefasern für Dämmstoffe verwendet. Sie nutzen sogenannte Bio-Abfallstoffe. Aber dann mischen sie diese mit 30 Prozent Polyethylen, einem Kunststoff, weil im Ofen alles zu einem elastischen Dämmmaterial verschmolzen werden kann. Die Firma beginnt also mit einem wertvollen natürlichen Rohstoff, verwandelt ihn aber in ein Produkt, das am Ende nicht mehr recycelbar ist. Es wird de facto zu Müll. Als ich das dem Geschäftsführer klarmachte, war er erst mal wütend und ging weg. Aber nach 20 Minuten kam er zurück und fragte: „Wie könnten wir es anders machen?“ Und wir haben begonnen, intensiv darüber nachzudenken.
Wie sieht die Welt also 2035 aus, was Nachhaltigkeit betrifft?
Hoffentlich besser. Unser Wirtschaftssystem funktioniert schon jetzt nicht mehr. Selbst mit einem guten Job kann man sich das Leben in den Niederlanden kaum noch leisten, weil die laufenden Kosten und auch die Preise im Supermarkt so stark steigen. Die Lebensmittel haben auch oft keinen Nährwert und schmecken nach nichts. Alles hängt miteinander zusammen. Viele wollen daran etwas ändern. Es gibt immer mehr Landwirte, die auf Qualität achten und dadurch deutlich mehr Einkommen pro Hektar erzielen.
Die Niederlande sind bei neuen nachhaltigen Materialien und beim Thema Kreislaufwirtschaft in Europa an der Spitze. Woran liegt das?
Zum Teil hat es historische Gründe. Was wir herstellen, diese Kombination aus Stärke und Pflanzenfasern, gab es in Friesland im Prinzip schon um 1870 herum. Damals suchte man nach einem Material, um Dampfrohre für die Industrie zu isolieren. Man hat es erst mit Stroh versucht, dann mit Stärke, denn die ist nicht brennbar. Ansonsten ist die niederländische Offenheit für neue Ideen und Technologien sehr förderlich. Viele Ideen entstehen aus dem Design heraus, und daraus entwickeln sich dann Unternehmen. Dafür braucht man das richtige Werkzeug – also fundiertes Wissen über Menschen, Materialien und Prozesse.
Welche Rolle spielt Design bei Ihrer Arbeit?
Design ist für mich zentral, weil es Kreativität mit Problemlösung verbindet. Ich frage mich immer: Könnte es auch anders funktionieren, und wie? Das ist genau das, was Designer tun: neue Ideen entwickeln, Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten, auch historisch, und sie neu einordnen.
Und wo sehen Sie Probleme in der heutigen Designwelt?
Viele Designer – auch bei großen Firmen wie Ikea – stecken in festen Strukturen. Sie denken nur noch innerhalb ihres Systems. Es fehlt der Mut, andere Gedanken zuzulassen. Das ist gefährlich, man wird zum Gefangenen seines eigenen Modells.
Alle Folgen der Serie „Wie leben wir 2035?“ finden Sie hier.
Collage: sted/SZ, Fotos: imago
Der Biochemiker und Ökotoxikologe Erik Slor, 48, ist Gründer des Unternehmens Dynaplak, das bei Groningen biobasierte Produkte ohne petrochemische Stoffe herstellt und dessen Spin-off Huis Veendam neue Materialien aus lokalen Naturfasern und Stärke entwickelt .